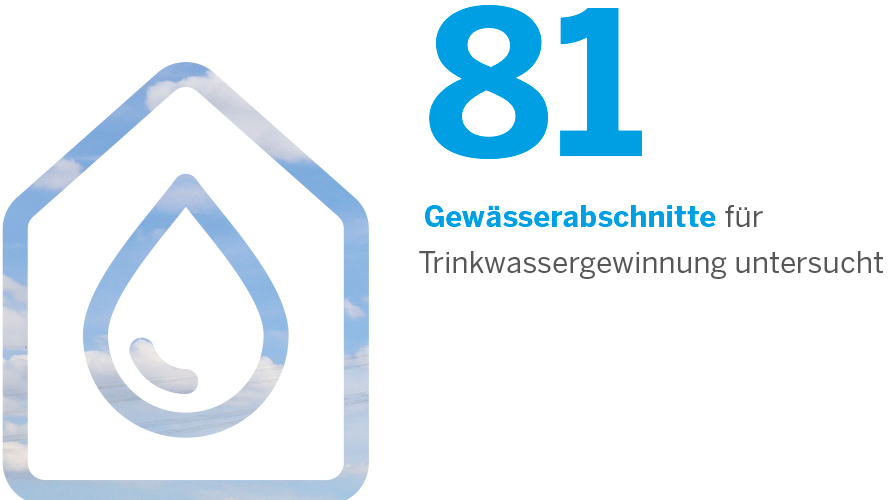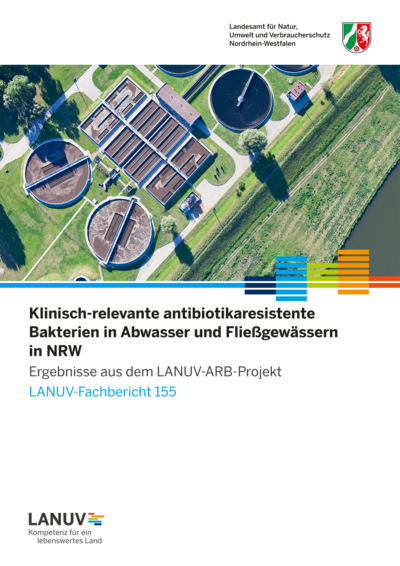Neue Herausforderungen beim Schutz von Grund- und Trinkwasser
Grundwasser ist für Natur und Mensch von besonderer Bedeutung. Es speist Flüsse, Seen und Feuchtgebiete, sichert das Überleben von Tieren und Pflanzen und dient als Trinkwasserreservoir. Für das LANUV erwächst daraus ein vielseitiges Aufgabenspektrum. Es identifiziert Grundwasservorkommen, analysiert die vom Menschen verursachten Stoffeinträge oder kümmert sich darum, die Qualität des Grundwassers zu verbessern und eine mengenmäßige Übernutzung zu vermeiden – um nur einige Themenfelder zu nennen. Durch die Folgen des Klimawandels steht das LANUV beim Schutz von Grund- und Trinkwasser vor neuen Herausforderungen – und setzt dafür neue spannende Projekte um.
Im Jahr 2023 wurde die novellierte Trinkwasserrichtlinie mit der Novelle der Trinkwasserverordnung und einer Trinkwassereinzugsgebieteverordnung in nationales Recht umgesetzt. Für den Fachbereich „Grundwasser, Wasserversorgung, Trinkwasser, Lagerstättenabbau“ bedeutet dies, Ideen für deren Umsetzung zu entwickeln. So baut er gemeinsam mit dem Fachbereich „Informationssysteme Wasser“ unter anderem Datenmodelle und Fachinformationssysteme auf und erarbeitet Konzepte, wie künftig Trinkwassereinzugsgebiete bewertet werden und ein risikobasiertes Monitoring aussehen könnten. „Die Identifikation und Darstellung aller Trinkwassereinzugsgebiete ist essenziell“, sagt die Fachbereichsleiterin Dr. Sabine Bergmann. „Nur so können Vorbeugemaßnahmen geplant und umgesetzt werden“. Dazu will das LANUV das bisherige Datenmanagementsystem so weiterentwickeln, dass alle wichtigen Informationen zur Risikobeurteilung zusammengeführt werden.
Zentrales Element sind die risikobasierten Monitoringprogramme, die die Betreiber in Abstimmung mit den Umwelt- und Gesundheitsbehörden aufzustellen haben. Das LANUV leistet mit dem Gewässer- und Grundwassermonitoring und mit der Bereitstellung von Daten dafür einen wichtigen Beitrag. Da auch Oberflächengewässer in NRW für die Trinkwassergewinnung genutzt werden, untersucht das LANUV 81 Gewässerabschnitte, die sich im Einzugsgebiet von Trinkwasserentnahmestellen befinden, um die für die Trinkwassergewinnung potenziell relevanten Schadstoffe frühzeitig festzustellen. Als Ergebnis der neuen Verordnung werden die Qualität der Rohwasserressourcen und die Risikobewertung der Trinkwassereinzugsgebiete erstmals auf Landes- und Bundesebene zusammenfassend dargestellt.
Die Trinkwasserversorgung ist aber auch vom mengenmäßigen Zustand des Grundwassers abhängig, insbesondere in Zeiten des Klimawandels und bei abnehmendem Dargebot. Das LANUV setzt schon jetzt auf Modelle, mit denen die Grundwasserneubildung und die Wasserhaushaltskomponenten unter dem Einfluss des Klimawandels bestimmt werden können. Weiterhin erarbeitet der Fachbereich ein Konzept, mit dem das nutzbare Dargebot ermittelt werden kann. Die nachhaltig zu bewirtschaftende Menge muss so bestimmt werden, dass etwa Schäden in Feuchtgebieten sowie das Trockenfallen von Gewässern oder Quellen vermieden werden können – und zwar auch dann, wenn beispielsweise Trockenperioden länger anhalten und drastischer ausfallen. Die Kombination aus Monitoring und Modellen soll auch helfen, die Ursachen leichter zu analysieren.
Auch bei anderen Themen bleibt der Fachbereich auf dem neuesten Stand, indem er weitere Projekte vorantreibt wie etwa zur Nitratbelastung. Da ein Teil der Nitrateinträge unter bestimmten Voraussetzungen, die jedoch begrenzt sind, zu molekularem Stickstoff abgebaut wird, lässt sich die tatsächliche Nitratbelastung des Grundwassers bislang nicht präzise darstellen. Das ist aber notwendig, weil Maßnahmen – etwa bei der landwirtschaftlichen Düngung – bisher vom gemessenen Nitratwert im Grundwasser abhängig gemacht werden und nicht vom tatsächlichen Stickstoffüberschuss. Der Fachbereich wendet nun gemeinsam mit der Abteilung „Zentrale Umweltanalytik“ die sogenannte N2/Ar-Methode an. Damit kann über die Messung der Stickstoff- und Argon-Konzentration im Grundwasser der von den Mikroorganismen verursachte Nitratabbau direkt bestimmt werden.
Um beim Ausbau der erneuerbaren Energien den Schutz des Grundwassers sicherzustellen, begleitet der Fachbereich in einem weiteren Projekt den Masterplan Geothermie des Landes in fachlicher Hinsicht. Zusätzlich gilt es, im Kontext des künftigen Grundwasserwiederanstiegs im Rheinischen Braunkohlerevier und des Grubenwasseranstiegs im Gebiet der ehemaligen Steinkohle geeignete Modelle sowie ein geeignetes Grundwassermonitoring zu erhalten, zu betreiben und weiterzuentwickeln. So wird aktuell eine Bestandsaufnahme aller grundwasserrelevanten Bergbaueinflüsse in einem weiteren Projekt durchgeführt. Zudem will der Fachbereich bis Ende 2027 ein Fachinformationssystem online stellen, das Bauherrinnen und Bauherren helfen soll, Ersatzbaustoffe aus mineralischen Abfällen wie Recyclingbaustoffe, Hausmüllverbrennungsasche, Baggergut und Bodenmaterial grundwasserschonend einzusetzen. Dies soll den künftigen Rohstoffverbrauch reduzieren.
Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels
Im Rahmen des 10-Punkte-Arbeitsplans „Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels“ hat das LANUV die Hochwasserzentrale für NRW aufgebaut, die seit September 2024 von Marc Scheibel geleitet wird. Zu ihren Aufgaben zählt unter anderen, dass sie die hydrologische Situation hinsichtlich einer möglichen Hochwasserentstehung im 24/7-Betrieb beobachtet und überwacht. Sie sammelt dafür die relevanten Daten, bewertet diese und stellt anschließend zusammengefasste Hochwasserinformationen für den Katastrophenschutz sowie für die Wasserwirtschaft der betroffenen Regionen bereit. Sämtliche Daten und Hochwasserinformationen werden auch für alle Bürgerinnen und Bürger auf dem Hochwasserportal.nrw sowie in der App „Meine Pegel“ veröffentlicht. Damit sollen eine mögliche Hochwassergefährdung frühzeitig erkannt und Betroffene zeitnah informiert werden. Maßgeblich erfüllen die Aufgaben der Hochwasserzentrale die Fachbereiche „Hochwasserzentrale, Hochwasserrisikomanagement, Stadtentwässerung und -hydrologie“ und „Hydrologie“. So wurde im Jahr 2024 unter anderem der Um- und Neubau von Pegeln forciert, mittels zusätzlichen und besseren Servern die technischen Systeme erweitert und der Austausch wasserwirtschaftlicher Daten für die Hochwasservorhersage zum Beispiel mit Wasserverbänden vorangetrieben.
Titelbild: Adobe Stock/Marcel Paschertz
Das Makrozoobenthos im Rhein
Der Fachbereich „Ökologie der Oberflächengewässer“ hat im Rahmen des „Rheinmessprogramms Biologie 2024/2025“ in einem engmaschigen, 14-täglichen Rhythmus an mehreren Probestellen entlang des Rheins in NRW die Menge an Chlorophyll a (als Maß für die Dichte des Phytoplanktons) gemessen. Zusätzlich wurde auf der 255 Kilometer langen Strecke des Rheins zwischen Bad Honnef und Bimmen das Makrozoobenthos erfasst. Dafür waren mehrere Biologisch-technische Assistentinnen und -Assistenten einige Tage mit dem Labor- und Probenahmeschiff „Max Prüss“ unterwegs. Mit dem Beiboot fuhren sie zu den Buhnen an beiden Uferseiten und sammelten dort bei Steinen unterhalb des Wassers das Makrozoobenthos ab. Dies sind wirbellose, oft nur wenige Millimeter bis Zentimeter große Tierchen in der Gewässersohle von Fließgewässern, zu denen beispielsweise Würmer, Schnecken, Muscheln, Krebstiere und einige Insektengruppen zählen. Die Ergebnisse der Artbestimmung und die anschließende Auswertung, die im Laufe des Jahres 2025 erwartet werden, geben Aufschluss über das ökologische Potenzial des Rheins. Dies wird auch in die Berichterstattung zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie einfließen.
Forschung zur Abwasserbeseitigung
Das NRW-Umweltministerium hat nach Auslaufen des Förderprogramms „Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung II (ResA II)“ im Oktober 2023 das Nachfolgeprogramm „Zukunftsfähige und nachhaltige Abwasserbeseitigung in NRW (ZunA NRW)“ aufgelegt. Ziel ist, den Stand der Technik der Abwasserbeseitigung weiterzuentwickeln. Dazu zählen etwa die Themen nachhaltige Abwasserbeseitigung, Schutz der natürlichen Ressourcen, Erhalt von Infrastruktur und Qualitätssicherung auf dem Gebiet der Abwasserbeseitigung. Der Fachbereich „Kommunales und industrielles Abwasser“ ist für den Förderbereich „Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Abwasserbeseitigung“ zuständig. Antragsberechtigt sind Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie Wasserverbände und Ingenieurbüros als Kooperationspartner. ZunA hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2028.
Antibiotikaresistente Bakterien in der aquatischen Umwelt
Klinisch-relevante antibiotikaresistente Bakterien kommen verbreitet in Abwässern und abwasserbeeinflussten Fließgewässern in NRW vor. Dies ist eines der zentralen Ergebnisse eines Projekts des LANUV. Wie aus dem Projektbericht hervorgeht, wurden Bakterien mit Resistenzen gegen drei von vier Antibiotikagruppen in Abwässern sämtlicher untersuchten Kläranlagen sowie sehr verbreitet in Fließgewässern gefunden. Bakterien mit Resistenzen gegen alle vier Antibiotikagruppen wies das LANUV vor allem in Krankenhausabwässern sowie in den aufnehmenden Kläranlagen und Fließgewässern nach. Infektionen mit solchen multiresistenten Bakterien sind nur sehr schwer therapierbar. Um noch mehr über die Belastung von Abwasser und Fließgewässern mit antibiotikaresistenten Bakterien zu erfahren, will das LANUV die Untersuchungen auf weitere Messstellen ausweiten.
Neue Webseite zu Mikroschadstoffen im Abwasser
Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung, aus Pilotprojekten und Studien, Informationen zur Förderung, Fachpublikationen – alles zum Thema Mikroschadstoffe im Abwasser veröffentlicht das LANUV in einem neuen Fachinformationssystem. Entwickelt wurde das Portal von der im Frühjahr 2024 im Fachbereich „Kommunales und industrielles Abwasser“ neu eingerichteten Kompetenzstelle „Mikroschadstoffe im Abwasser“. Es richtet sich an die Fachöffentlichkeit, Behörden, Planungsbüros, Betreibende von kommunalen Kläranlagen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die neue Wege in der Abwasserbehandlung gehen wollen. Es werden Lösungsansätze zur Reduzierung von Mikroschadstoffeinträgen in Gewässer aufgezeigt. Der Fokus liegt auf verfahrenstechnischen Ansätzen in Kläranlagen, mit denen sich Mikroschadstoffe aus dem Abwasser weitestgehend entfernen lassen. Bereits 22 Kläranlagen sind in NRW mit einer vierten Reinigungsstufe ausgebaut, zehn Anlagen befinden sich im Bau und weitere 17 Kläranlagen sind geplant. Mehr als 100 Kläranlagen sollen in den nächsten Jahren zusätzlich ausgebaut werden.
Externer Inhalt
Schutz Ihrer Daten
An dieser Stelle haben wir den Inhalt eines Drittanbieters, bspw. YouTube, X, Instagram etc., eingebunden. Bitte bestätigen Sie über den Button, dass Sie damit einverstanden sind, diese Inhalte zu sehen!
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutz.